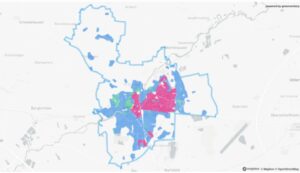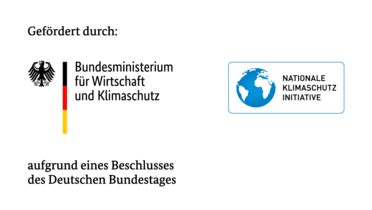Ein Kältenetz transportiert ein kaltes Fluid, um angeschlossene Gebäude zu kühlen. Aus aktueller Sicht sind für das Stadtgebiet in Dachau keine Kältenetze geplant, können aber in Zukunft aufgrund steigender Temperaturen und Komfortanforderungen ein Thema werden.
Ein flächiges Kältenetz ist im Stadtgebiet Dachaus aktuell nicht geplant. Potenzielle Wärmekunden können über den Einsatz einer Absorptionskältemaschine künftige Fernwärme im Sommer auch zur Kühlung verwenden.