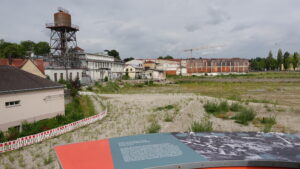10 Fragen und Antworten:
- Was bedeutet „Dachauer Grundsätze der Baulandentwicklung?“
- Warum braucht Dachau eine sozialgerechte Bodennutzung?
- Was sind Folgelasten bzw. Folgekosten?
- Was ist der „Pauschalbetrag“ und wie wurde er ermittelt?
- Wo und ab welcher Flächengröße werden die Dachauer Grundsätze angewendet?
- Was ist unter „Dachauer Modell zur Wohnraumförderung“ zu verstehen und wie funktioniert es?
- Welche technischen Standards sind beim Dachauer Modell zu beachten?
- Welche Verträge sind erforderlich?
- Wen betreffen die Regelungen und wer sind „Planungsbegünstigte“?
- Wie sieht der zeitliche Ablauf aus?
1. Was bedeutet „Dachauer Grundsätze der Baulandentwicklung“?
Der Begriff „Dachauer Grundsätze der Baulandentwicklung“ bezieht sich auf die vom Stadtrat gewollte und beschlossene „sozialgerechte Bodennutzung“ für neue Wohnbauprojekte im gesamten Stadtgebiet Dachau. Die sozialgerechte Bodennutzung wird in anderen Städten bereits seit vielen Jahren erfolgreich praktiziert und ist in München unter dem Begriff „SoBoN“ bekannt. Ziel ist, dass bei Neuausweisung von Wohnflächen auch ein Teil der Wohngebäude für den kostengünstigeren bzw. geförderten Wohnungsbau bereitgestellt wird und die Kosten für die soziale Infrastruktur vom Investor mitbezahlt werden. In der Regel werden insgesamt 30% der neugeschaffenen Wohnbaufläche für den geförderten Wohnungsbau bereitgestellt. Dabei soll regelmäßig ein Anteil von 20% der neugeschaffenen Wohnbaufläche für den geförderten Mietwohnungsbau entsprechend dem staatlichen Modell der einkommensorientierten Förderung (EOF) und 10% für das „Dachauer Modell zur Wohnraumförderung“ mit geförderten Eigentumswohnungen verwendet werden. Eine Flexibilisierung zwischen diesen Prozentanteilen erlaubt auch andere Modelle des geförderten Wohnungsbaus, wie etwa genossenschaftliches Wohnen oder Ähnliches.
2. Warum braucht Dachau eine sozialgerechte Bodennutzung?
Die Stadt hat die Aufgabe, eine geordnete Entwicklung in der Gemeinde sicher zu stellen: Die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere auch von kinderreichen Familien, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung sind bei der Planung zu berücksichtigen. Durch die weiterhin hohe Wohnraumnachfrage mit ansteigenden Preisen gibt es für Haushalte mit geringerem Einkommen erheblich weniger Wohnraumangebot im Stadtgebiet, was zur Verdrängung ins günstigere Umland führen kann. Zudem müssen die Lasten und Kosten getragen und finanziert werden, die bei der Neuausweisung von Bauland für die Stadt entstehen. Die Stadt Dachau braucht daher eine sozialgerechte Bodennutzung damit die Kosten, die der Stadt und damit auch dem Steuerzahler durch die Neuausweisung von Wohnbauflächen entstehen, zu einem Teil von den Planungsbegünstigten übernommen werden sollen.
3. Was sind Folgelasten / Folgekosten?
Bei der Neuausweisung von Bauland entstehen für die Stadt in der Folge Lasten und auch Kosten, die als Folgelasten / Folgekosten bezeichnet werden: Neu hinzukommende Bürgerinnen und Bürger benötigen außer Wohnraum, Grün- und Freiflächen auch technische und soziale Infrastruktur. Zur technischen Infrastruktur zählen beispielsweise Wege / Straßen, öffentliche Buslinien sowie die Ver- und Entsorgung. Zur sozialen Infrastruktur zählen beispielsweise Einrichtungen für die Kinderbetreuung und Schulen, aber auch sonstige Einrichtungen für alle Altersgruppen. Dies alles muss von der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Für die Folgekostenermittlung werden nur die Kosten für die soziale Infrastruktur mit den Kinder- und Schuleinrichtungen berücksichtigt.
4. Was ist der „Pauschalbetrag“ und wie wurde er ermittelt?
Der sogenannte „Pauschalbetrag“ ist der Anteil der Folgelasten für die neu ausgewiesene Wohnbaunutzung, der auf einen Quadratmeter neu geschaffener Geschossfläche für Wohnnutzung entfällt. Vom Eigentümer bzw. Investor, zu dessen Gunsten die Ausweisung neuer Wohnbaunutzung erfolgt, ist dieser Betrag zu leisten. Der Pauschalbetrag beträgt derzeit 78,73 €/m²; er bezieht sich auf den Datenstand zum Jahreswechsel 2016/2017. Für die Kostenberechnungen sind Daten von städtischen Kindertagesstätten, Grund- und Mittelschulen herangezogen worden. Der Stadtrat hat einen einheitlichen Pauschalbetrag festgelegt, damit nicht bei jeder Baulandausweisung die dadurch entstehenden Folgekosten, die von Planungsbegünstigten zu leisten sind, errechnet werden müssen. Dieser Pauschalbetrag wird zukünftig fortgeschrieben und an die Kostenveränderungen angepasst.
5. Wo und ab welcher Flächengröße werden die Dachauer Grundsätze angewendet?
Ab 500 m² neu geschaffener Geschossfläche für Wohnnutzung innerhalb eines Bebauungsplans bzw. innerhalb einer Satzung kommen die Dachauer Grundsätze zur Anwendung. Die Dachauer Grundsätze der Baulandentwicklung werden nur angewendet bei Neuschaffung von Baurecht für Wohnnutzung durch Bebauungsplan oder sonstiger Satzungen nach dem BauGB, nicht jedoch im Rahmen von Baugenehmigungen innerhalb bestehender Bebauungspläne und im unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 BauGB.
6. Was ist unter „Dachauer Modell zur Wohnraumförderung“ zu verstehen und wie funktioniert es?
Das Dachauer Modell zur Wohnraumförderung, welches für 10% der neugeschaffenen Wohnbauflächen zur Anwendung kommen soll, wurde insbesondere für Familien und Dachauer mit weniger Kaufkraft geschaffen. Es ermöglicht die vergünstigte Veräußerung von Eigenwohnraum an Bevölkerungsschichten, die regelmäßig keine staatliche Wohnraumförderung erhalten und auf dem freien Wohnungsmarkt nur geringe Erfolgsaussichten haben. Die Vergünstigung besteht aus einer Festlegung des Verkaufspreises auf 80% des durchschnittlichen Verkaufswertes neuer Eigentumswohnungen in Dachau. Die Wohnungen werden öffentlich ausgeschrieben und nach festgelegten Auswahlkriterien vergeben: Bewerber mit höherer Punktezahl genießen Vorrecht gegenüber Bewerbern mit niedrigerer Punktezahl. Punkte gibt es beispielsweise für Kinder im Haushalt, für die Einkommensklasse sowie für einen eventuellen Behinderungs- oder Pflegegrad des Antragsstellers oder seiner Angehörigen. Als weitere Entscheidungskriterien werden die bestehende Dauer des Hauptwohnsitzes in Dachau sowie ein Hauptberuf im Stadtgebiet herangezogen. Zur Sicherung des Förderzwecks sind die Begünstigten verpflichtet, ihren Wohnsitz im Regelfall für mindestens 15 Jahre in der erworbenen Wohnung zu behalten; ein Rechtsanspruch auf den Erwerb einer geförderten Eigentumswohnung besteht nicht.
Mehr zum Dachauer Modell zur Wohnraumförderung und zu den Richtlinien der Erwerberauswahl lesen Sie unten in der PDF-Datei.
7. Welche technischen Standards sind beim Dachauer Modell zu beachten?
Bei der Erstellung von vergünstigten Wohnungen sind Vorgaben zu bestimmten Standards einzuhalten wie beispielsweise die maximalen Wohnungs- und Raumgrößen, Barrierefreiheit, Anforderungen für die Nutzung durch Menschen mit Behinderung, Stellplatzzuordnung u.s.w. Die Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (WoFIV) ist Bestandteil der Standardkriterien.
8. Welche Verträge sind erforderlich?
Als Voraussetzung für die Ausweisung von Wohnbauland müssen zwischen der Stadt und den Planungsbegünstigten Verträge abgeschlossen werden. Zu Beginn wird die Grundlagenvereinbarung unterschrieben: hier werden die vom Stadtrat beschlossenen grundlegenden Inhalte und Eckpunkte für die gemeinsame Baulandentwicklung geregelt (Kosten, Lasten, Pflichten, Ziele,..). Im später darauf aufbauenden städtebaulichen Vertrag wird die gesamte Umsetzung der Baulandentwicklung im Einzelnen geregelt (genauere Regelungen beispielsweise zu Planungszielen, Grundstückswertfeststellung, Kostentragung, Folgekosten, Erschließung, Förderinhalte, Standards, Flächenzuordnung – und -Abtretung, Termine / Fristen,…). Dieser städtebauliche Vertrag wird in der Regel von einem Notar beurkundet.
Mehr zur Grundlagenvereinbarung lesen Sie unten in der PDF-Datei.
9. Wen betreffen die Regelungen und was sind „Planungsbegünstigte“?
Die Regelungen betreffen alle Personen, die am Prozess der Baulandentwicklung teilnehmen: Dies sind die Grundstückseigentümer, die Investoren und auch Käufer von vergünstigten Wohnungen. „Planungsbegünstigte“ sind Grundstückseigentümer oder Investoren, deren Grundstücke durch die Baulandentwicklung eine Wertsteigerung erhalten. Ihre Grundstücke können nach der Baulandentwicklung, das heißt nach Inkrafttreten des Bebauungsplans, zu einem wesentlich höheren Wert verkauft werden, als davor. Deshalb muss beispielsweise der Pauschalbetrag von den „Planungsbegünstigten“ gefordert werden. Deshalb muss beispielsweise der Pauschalbetrag von den Planungsbegünstigten gefordert werden. Insgesamt soll mindestens 1/3 des Bruttowertzuwachses des Bodenwertes beim Eigentümer verbleiben.
10. Wie sieht der zeitliche Ablauf aus?
Der Stadtrat entscheidet über die grundlegenden Planungsziele der Stadtentwicklung im Stadtgebiet und somit auch über die Baulandentwicklung von Grundstücken.
- Erster Schritt ist die Vorberatungsphase mit vorläufiger Abgrenzung eines Plangebietes und der Abschluss einer Grundlagenvereinbarung zwischen der Stadt und den Planungsbegünstigten
- Zweiter Schritt ist die Planungs- und Vertragsphase:
- Zu Beginn erfolgt in der Regel der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan und ggf. der Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans als Voraussetzung für den Beginn aller Planungen. Es erfolgt in der Regel auch die gutachterliche Feststellung des Anfangswertes der Flurstücke im Planbereich.
- Parallel zur Planung wird der städtebauliche Vertrag zwischen der Stadt und den Planungsbegünstigten abgestimmt: Hier werden alle wesentlichen Themen, die zur konkreten Umsetzung der Planung erforderlich sind, geregelt und auch alle durch die Planung entstehenden Kosten ermittelt. Vor Vertragsabschluss wird das Endwertgutachten erstellt und die Angemessenheit überprüft. Bereits in dieser Phase sind sämtliche Planungsinhalte, Termine und Kostenwerte erfasst und geregelt.
- Vor der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans wird der städtebauliche Vertrag nach Billigung durch den Stadtrat abgeschlossen und beurkundet.
- Nach der öffentlichen Auslegung entscheidet der Stadtrat über den weiteren Planungsverlauf: Wenn sich keine wesentlichen Planungsänderungen ergeben, kann der Satzungsbeschluss gefasst werden und der Bebauungsplan zur Rechtskraft gebracht werden. Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplans besteht Baurecht.
- Dritter Schritt ist die Phase der Baureifmachung und der Objektplanung:
Die Vertragsinhalte des städtebaulichen Vertrages werden jetzt schrittweise umgesetzt. In dieser Phase werden beispielsweise die erforderlichen öffentlichen Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt sowie die Ausführungsplanungen erstellt. Die Stadt schreibt zu einem Stichtag die zu vergebenden Wohnungen nach dem Dachauer Modell öffentlich aus und übergibt dem Eigentümer bzw. Investor eine Liste mit ausgewählten Förderberechtigten, mit denen dieser die Wohnungskaufverträge abzuschließen hat. Die Planung der geförderten Mietwohnungen nach EOF erfolgt in direkter Abstimmung mit der Regierung von Oberbayern als Förderbehörde.
- Vierter Schritt ist die Bau- und Umsetzungsphase: Sobald die Baugenehmigung vorliegt werden die Gebäude errichtet. Vor Fertigstellung der Gebäude mit geförderten Mietwohnungen werden die förderberechtigten Mieter ausgewählt und die neuen Wohnungen zugeteilt.
- Fünfter Schritt ist die Abschlussphase: In dieser Phase werden sämtliche Abrechnungen erfasst und der Vollzug des städtebaulichen Vertrages kontrolliert, bis alle Vertragsinhalte vollzogen sind.